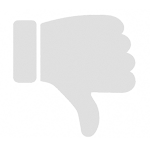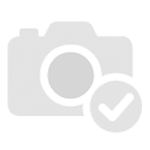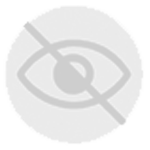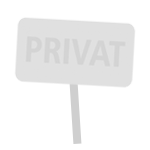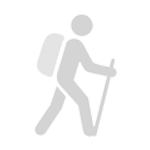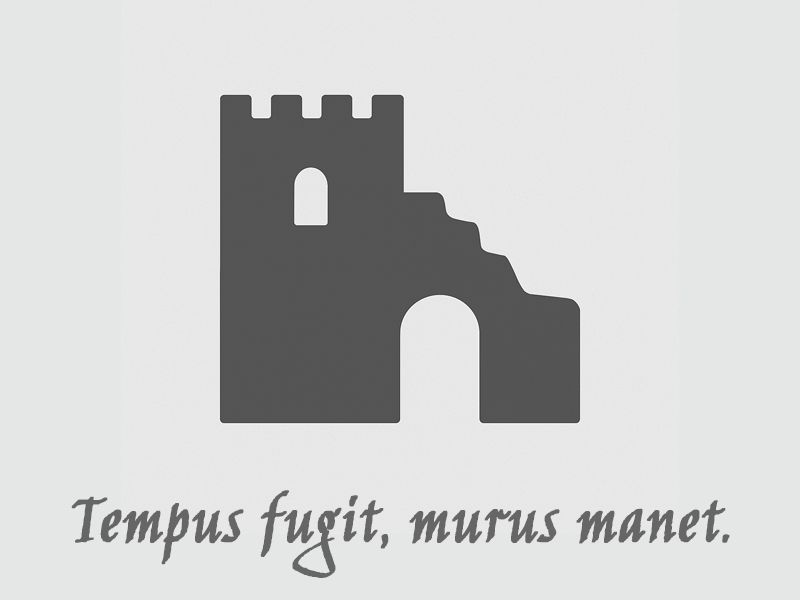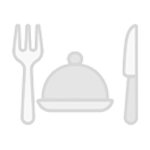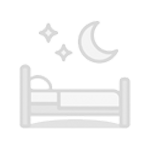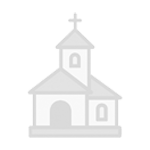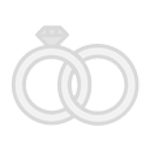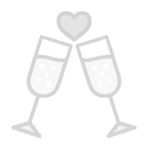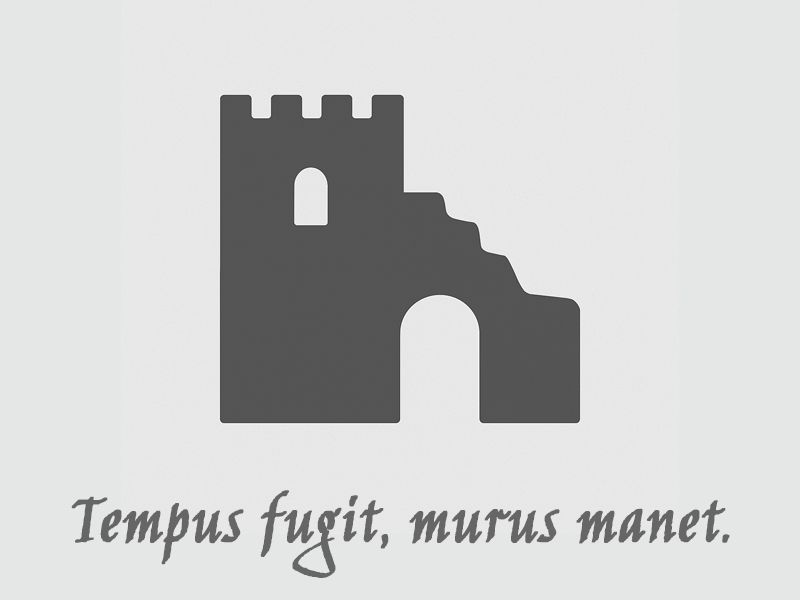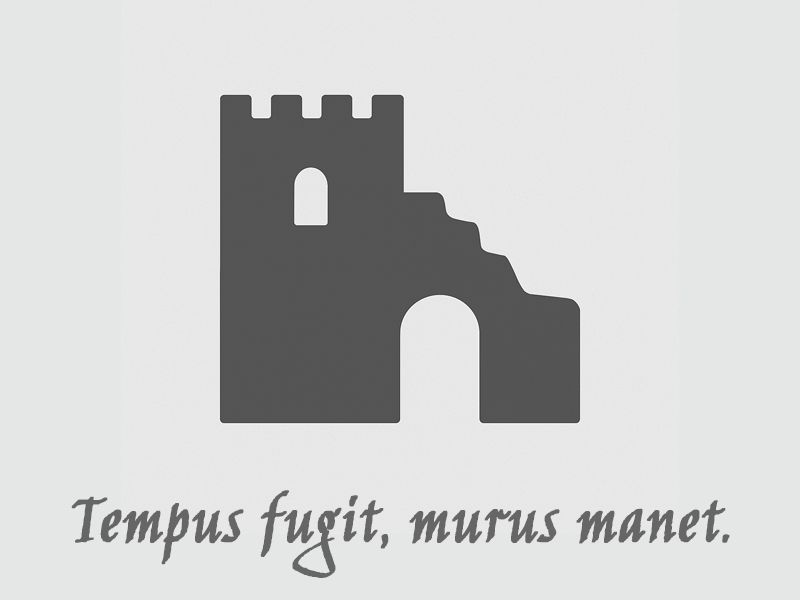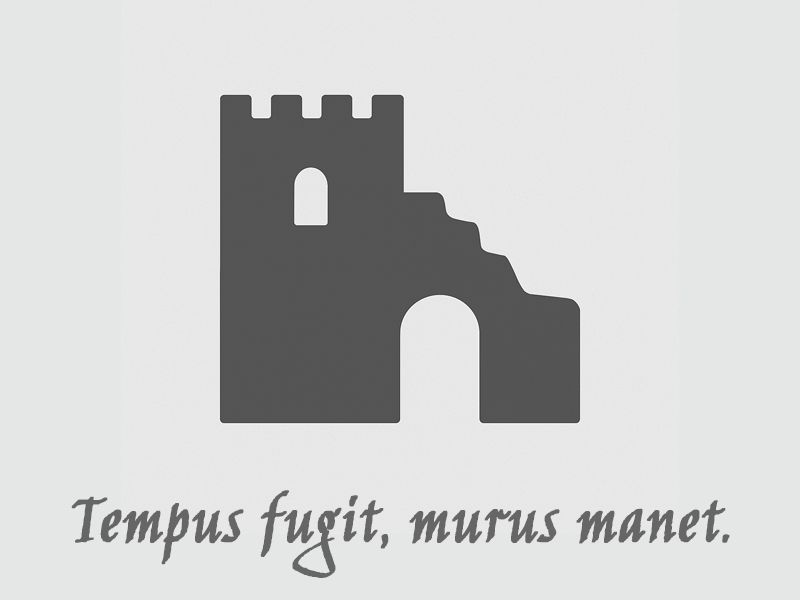Beschreibung und Geschichte
Die Ruine Falkenburg � Herrschaft, Verteidigung und Identität im Mittelalter
Gründung im hochmittelalterlichen Umbruch
Die Gründung der Falkenburg bei Detmold-Berlebeck um
1194/95 fällt in eine Phase massiver Umbrüche. In dieser Zeit entstanden viele Burgen zur Absicherung und Ausweitung adliger Territorien. Die Edelherren zur Lippe � besonders
Bernhard II. � nutzten diese Gelegenheit, um ihren Machtbereich aus dem Gebiet um Lippstadt in das östliche Westfalen zu erweitern. Die Gründung der
Falkenburg war dabei Teil eines gezielten Territorialaufbaus, der durch die Städte
Lippstadt und
Lemgo ergänzt wurde.
Bernhard II. zur Lippe � der politische Gründer
Bernhard II., geboren um
1140, war ursprünglich für eine kirchliche Laufbahn vorgesehen, trat aber nach dem Tod seines Bruders in die weltliche Herrschaft ein. Um
1165/1170 heiratete er
Heilwig von Are, mit der er elf Kinder hatte. Er war ein loyaler Anhänger
Heinrichs des Löwen und kommandierte dessen Truppen bis 1181. Nach Rückzug aus der Politik trat er in das
Kloster Marienfeld ein, ging später auf Kreuzzug ins Baltikum und wurde
Bischof von Semgallen. Er starb hochgeehrt im Jahr
1224.
Die Burg als Zentrum von Herrschaftsausübung
Die Falkenburg entwickelte sich rasch zum Verwaltungszentrum.
Bernhard III., der Enkel des Erbauers, stellte hier
Urkunden aus � ein Zeichen schriftlich organisierter Herrschaft. Die Burg war ein Symbol
reichsunmittelbarer Autonomie. Eine integrierte
Kapelle unterstrich zudem die religiöse Funktion. Zusammen mit dem Kloster Marienfeld entstand eine Verbindung aus weltlicher und geistlicher Machtausübung.
Adlige Selbstbehauptung im Spätmittelalter
Im 15. Jahrhundert blieb die Burg trotz wachsender Konflikte ein militärisches Bollwerk. In der:
- Eversteiner Fehde (1404�1409)
- Soester Fehde (1444�1449)
wurde die Burg belagert, jedoch nie eingenommen. Ein Brand
1453 beschädigte Teile der Anlage, doch sie blieb bis
1523 in Nutzung. Die Residenz verlagerte sich dann endgültig nach
Detmold.
Frühneuzeitlicher Niedergang
Ab dem 16. Jahrhundert verlor die Burg ihre Funktion. Im Jahr
1802 wurde sie sogar zum
Steinbruch freigegeben � ein Schicksal, das viele Burgen in der Moderne traf. Mauerwerk wurde für Straßen- und Häuserbau entnommen, was den Verfall beschleunigte.
Wissenschaftliche Erschließung ab 2004
Erst ab dem Jahr
2004 wurde der historische Wert wieder erkannt. In Zusammenarbeit mit:
- dem Lippischen Landesmuseum Detmold
- der LWL-Archäologie für Westfalen
- der LWL-Denkmalpflege
- der Stadt Detmold
- und dem Verein Die Falkenburg e.V.
wurde ein Konzept zur
archäologischen Sicherung und Erhaltung entwickelt. Eine Vermessung durch die Altertumskommission zeigte: Mauerwerk war teilweise noch bis zu
3 Meter hoch erhalten.
Restaurierungsarbeiten und heutiger Zustand
Zwischen
2005 und 2019 fanden umfassende
Ausgrabungen und
Sicherungen statt. Die Mauern wurden stabilisiert, aber bewusst nicht rekonstruiert. Heute können Besucher eine authentische, nicht modern überformte
mittelalterliche Höhenburg erleben � mit deutlich erkennbaren Strukturen von
Ringmauer,
Bergfried,
Palas,
Zwinger und
Vorburg.
Symbol lippischer Identität
Die Falkenburg verkörpert:
- die Verdichtung regionaler Herrschaft im Mittelalter
- die Zusammenarbeit von weltlicher und geistlicher Macht
- das Wechselspiel zwischen Regionalpolitik und Reichskrisen
Sie ist ein Zeugnis der Adelsgeschichte, der Fehdenzeit und der Staatsbildung auf kleinstem Raum. Als Symbolfigur des lippischen Geschichtsraumes hat sie bis heute Bedeutung für kulturelle Identität und historische Bildung.
Quellen
- Förderverein Die Falkenburg e.V.
- Lippisches Landesmuseum Detmold
- LWL-Archäologie und Denkmalpflege für Westfalen
- Beiträge der Altertumskommission für Westfalen
- Historische Literatur zu Bernhard II. zur Lippe und Heinrich dem Löwen
- Forschung zur Stadt- und Burgenpolitik in Westfalen
(gw)
Die Ruine Falkenburg im Teutoburger Wald besteht aus den Überresten einer einstmals stolzen und praktisch uneinnehmbaren Trutzburg. Erbaut wurde die Falkenburg vermutlich ab 1194 durch Bernhard II. zur Lippe, dessen Sohn Hermann II. den Bau später für seinen Vater fortführte. Von Anfang an gab es Probleme mit der Falkenburg, da die Herren zu Lippe sie in einem Forstgebiet des Bischofs von Paderborn errichtet hatte. Der war mit dieser Nutzung seines Waldes natürlich nicht einverstanden. Durchsetzen konnte er sich aber nicht, denn schliesslich schaffte es die Familie zu Lippe es, das Gebiet rund um die Falkenburg als Lehen zu erhalten. Nicht viel später soll das Grundstück mit seinen umliegenden Ländereien sogar ganz in den Besitz der lippischen Familie übergegangen sein.
Heute geht man davon aus, dass man die Falkenburg als Ursprungsort des Fürstentums Lippe betrachten kann. Von hier aus besiedelten Adlige die gesamte Region. Und das mit Erfolg. Das zur Falkenburg gehörige Gebiet reichte schon zum Ende des 14. Jahrhunderts von Hiddensen bis Oesterholz.
Bei der Falkenburg handelte es sich nicht nur um eine einfache Befestigung, sondern um eine starke Trutzburg, die als uneinnehmbar galt. Ihrem Ruf vorauseilend verwendete man die Falkenburg darum im Jahr 1404 als Gefängnis für den Herzog Heinrich von Braunschweig-Lüneburg und seine Männer. Sie waren im Laufe einer Fehde festgesetzt worden und wurden erst gegen ein Lösegeld von 100.000 Goldtalern wieder freigelassen. Besagter Herzog hatte aus seiner Geiselhaft auf der Falkenburg aber offenbar nicht viel gelernt und versuchte nur kurze Zeit später vergebens, die Burg gewaltsam einzunehmen.
Obwohl 1409 schliesslich Frieden geschlossen werden konnte, gab es in den folgenden Jahren zahlreiche Fehden, während derer versucht wurde, die Falkenburg zu erstürmen. 27.000 Söldner sollen im Auftrag des damaligen Kölner Erzbischofs die ganze Gegend verwüstet und sämtliche Burgen eingenommen haben - nur die Falkenburg nicht. Selbst ein Tunnel, mit dem die Söldner die Falkenburg erobern wollten und der heute noch zu besichtigen ist, brachte keinen Erfolg.
Die Uneinnehmbarkeit der Falkenburg wird heute auf die mächtige Ringmauer der Burg zurückgeführt, die von einem Graben und Palisaden geschützt wurde. Selbst der Eingang zur Falkenburg wurde mit vier Toren geschützt und war dadurch praktisch uneinnehmbar.
Beschädigt wurde die Falkenburg dann letztendlich auch nicht durch fremde Söldner, sondern durch die Burgherren selbst. Im Jahr 1453 soll der damalige Burgherr, Bernhard der Siebte, einen Feldzug in der Burg gefeiert haben. Bei der Vorbereitung des Festmahls geriet offenbar die Küche der Falkenburg in Brand, die den Palas und weitere Teile der Anlage in Flammen aufgehen liess und teilweise zerstörte. Spuren davon sind noch heute überall in der Burg zu entdecken.
Da die Falkenburg hochmittelalterlichen Ansprüchen gemäss gebaut wurde, verlor man im Laufe des 16. Jahrhunderts das Interesse an ihr. Die Burg entsprach nicht mehr dem zeitgenössischen Geschmack und wurde als zu unbequem und kalt betrachtet. Schon früh begannen die Herren von Lippe darum, der Falkenburg die Wasserburg Detmold vorzuziehen, die später zu einem Schloss ausgebaut wurde. Wenige Zeit später wurde dann auch das mit der Falkenburg verbundene Amt an einen anderen Ort verlegt.
Die Burg selbst verfiel in den nachfolgenden Jahren zunehmend, nicht zuletzt deshalb, weil man Teile der Falkenburg abriss. Die hieraus gewonnenen Steine wurden unter anderem für den Bau von Strassen und Häusern verwendet. Dieser Raubbau an der Falkenburg zog sich bis ins 20. Jahrhundert hinein. Selbst im zweiten Weltkrieg wurden noch Steine aus der Burganlage gebrochen und für den Hausbau verwendet. Erst danach wurden die Schönheit und die historische Bedeutung der Falkenburg wieder neu entdeckt.
So wurde nach und nach der Bergfried rekonstruiert und erneuert. Bei archäologischen Grabungen konnten grosse Teile der Anlage freigelegt werden, so zum Beispiel die Ringmauer, die Toranlage und das Hauptgebäude.
(rh)